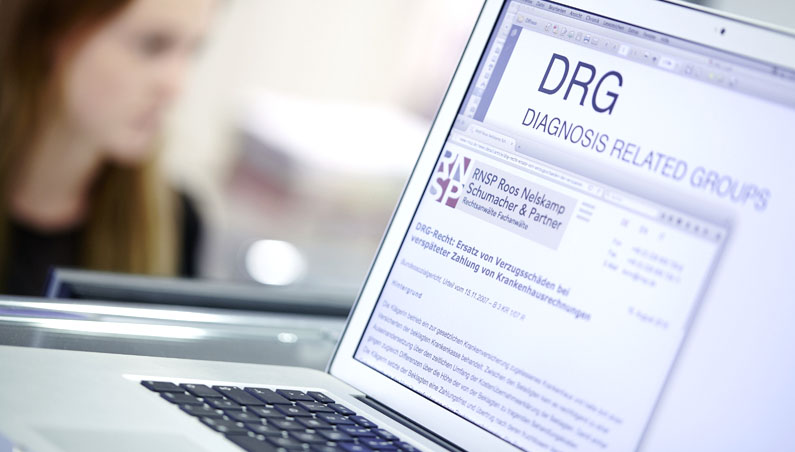Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 11. April 2017
Hintergrund
Bei der Beschwerdeführerin wurde eine Autoimmunkrankheit diagnostiziert, die mit verschiedenen Folgeerkrankungen beziehungsweise Komplikationen, insbesondere einer bereits mehrfach aufgetretenen Zungenschwellung, verbunden ist. Um auf die dadurch drohende Erstickungsgefahr reagieren zu können, führte die Beschwerdeführerin stets ein Notfallset mit sich. Zudem beantragte sie bei der im Ausgangsverfahren beklagten Krankenkasse die Kostenübernahme für eine intravenöse Immunglobulintherapie. Die Beklagte lehnt den Antrag mit der Begründung ab, dass die Voraussetzungen für einen sogenannten Off‑Label‑Use der Immunglobuline, die für die Behandlung der bei der Beschwerdeführerin vorliegenden Erkrankungen nicht zugelassen sind, nicht vorlägen. Auf die Klage der Beschwerdeführerin verurteilte das Sozialgericht die Beklagte, die Kosten für eine intravenöse Immunglobulintherapie zu übernehmen. Das Landessozialgericht wies die Berufung der Beklagten zurück. Auf die Revision der Beklagten hob das Bundessozialgericht die Urteile des Sozialgerichts und des Landessozialgerichts auf und wies die Klage ab.
Im Rahmen ihrer Verfassungsbeschwerde macht die Beschwerdeführerin geltend, dass ihr ein Anspruch auf die streitige Versorgung zustehe, da sie an einer lebensbedrohlichen und seltenen Erkrankung leide, für die keine etablierten Behandlungsmethoden, insbesondere keine zugelassenen Arzneimittel, zur Verfügung stünden, auf die sie zumutbar verwiesen werden könnte.
Die Verfassungsbeschwerde wurde nicht zur Entscheidung angenommen, da sie unzulässig ist.
Gründe
Im Beschluss vom 06. Dezember 2005, auf den sich die Beschwerdeführerin wiederholt beruft, hat das Bundesverfassungsgericht aus der allgemeinen Handlungsfreiheit, dem Sozialstaatsprinzip und dem Grundrecht auf Leben einen verfassungsunmittelbaren Anspruch auf Krankenversorgung abgeleitet, wenn in Fällen einer lebensbedrohlichen oder regelmäßig tödlichen Erkrankung vom Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung umfasste Behandlungsmethoden nicht vorliegen und die vom Versicherten gewählte Behandlungsmethode eine auf Indizien gestützte, nicht ganz fernliegende Aussicht auf Heilung oder wenigstens auf eine spürbar positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf verspricht. Allerdings würde es dem Ausnahmecharakter eines solchen Leistungsanspruchs nicht gerecht, wenn man diesen in großzügiger Auslegung der Verfassung erweitern würde. Eine derartige Gefährdungslage sei erst in einer notstandsähnlichen Situation, in der ein erheblicher Zeitdruck für einen zur Lebenserhaltung bestehenden akuten Behandlungsbedarf typisch sei. Anknüpfungspunkt eines derartigen verfassungsrechtlich gebotenen Anspruchs sei deswegen allein das Vorliegen einer durch nahe Lebensgefahr gekennzeichneten individuellen Notlage.
Die Beschwerdeführerin habe die mögliche Verletzung ihrer Grund- oder grundrechtsgleichen Rechte in Hinblick auf diese Grundsätze nicht hinreichend substantiiert und damit nicht entsprechend den Anforderungen aus § 23 Abs. 1 Satz 2, § 92 BVerfGG dargetan. Konkret habe die Beschwerdeführerin nur die Verletzung ihres Grundrechts aus Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip sowie ihres Grundrechts aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG gerügt. Wie die Fachgerichte zutreffend festgestellt hätten, ließen sich die potentiell letale Komplikation im Falle der Beschwerdeführerin hinreichend zuverlässig durch die ihr zur Verfügung stehenden Mittel verhindern. Somit fehle es vorliegend an der erforderlichen notstandsähnlichen Lage, die hinreichend Grund gäbe, um den gesetzgeberischen Spielraum bei der Ausgestaltung des Leistungsrecht der gesetzlichen Krankenversicherung durch einen unmittelbar aus der Verfassung abgeleiteten Anspruch zu überspielen. Ein entsprechender Anspruch der Beschwerdeführerin ist ausgeschlossen.
Bewertung
Dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts ist zuzustimmen. In Berufung auf die im Beschluss vom 06. Dezember 2005 (BVerfGE 115,25) aufgestellten Kriterien zur Gewährung eines verfassungsunmittelbaren Leistungsanspruchs stützt es zum einen seine eigene Rechtsprechung und zum anderen die Festigkeit der Verfassung. Ansonsten würde das Kostenübernahmesystem der Krankenkassen letztlich immer durch einen derartigen Anspruch aufgeweicht und die Grenzen der Notwendigkeit dessen Gewährung verwischt.